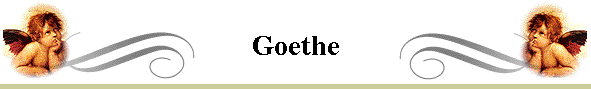|
Goethe und Gott
Sein Leben lang suchte der große Dichter nach der wahren Religion. Am ehesten fand er sie in der NaturVON ULRICH BEER
»Keine Religion, die auf Furcht gegründet ist, wird bei uns geachtet«: Goethe
Seine Kindheit und Jugend waren streng lutherisch geprägt. Doch schon bald erklärte er Pluralismus und Toleranz zum wahren Ziel: Johann Wolfgang von Goethe, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr zu feiern ist. Bis heute rätseln Experten über seinen widersprüchlichen Glauben. Eins scheint aber sicher: So wenig Zutrauen er zur Kirche entwickelte, so wichtig war ihm die Suche nach den »echten Religionen«. Mit diesem Beitrag startet DS eine lockere Reihe, die sich im Goethe-Jubeljahr mit verschiedenen Aspekten des deutschen »Dichterfürsten« befasst - mit Leben und Werk eines beispielhaft modernen Menschen
Manchmal ist es mit dem Glauben wie mit einem Schmuckstück: Man hängt sein Herz daran, stellt es ein paar Jahre zur Schau und lässt es von anderen bewundern. Doch dann gerät es in Vergessenheit, bis es, Jahre oder Jahrzehnte später, mit Staunen und Ehrfurcht wieder hervorgekramt wird.
Manchmal ist es mit dem Glauben so, doch nicht bei Johann Wolfgang von Goethe. Hanns Lilje, der Bischof und Zeitungsmann, hat dieses wunderbare Bild vom Schmuckstück vor fünfzig Jahren geprägt, in einem Vortrag zum 200. Geburtstag des Dichters. Lilje betonte damals, dass bei Goethe "das Religiöse nicht einfach ein Teilgebiet aus dem Lebenswerk des umfassenden Geistes" war, noch viel weniger "ein traditionalistisches Überbleibsel, einem alten Schmuckstück vergleichbar".
Das Religiöse war bei ihm von zentraler Bedeutung, in seinem Werk wie in seinem Leben. Strittig war aber stets, ob er einer religiösen Naturverehrung, einem Pantheismus oder einem aufklärerischen, modernen Christentum jenseits konfessioneller Bindungen anhing. Das hat viel mit seiner religiösen Biographie zu tun.
Goethes frühe Kindheit war vom Luthertum geprägt. Im Haus des Kaiserlichen Rates Johann Caspar Goethe in der freien Reichsstadt Frankfurt, als dessen ältester Sohn Johann Wolfgang in der Mittagsstunde des 28. August 1749 geboren wurde, waren der Kirchgang, der Gebrauch des Gesangbuches und der Bibel selbstverständlich. Ja, das lutherische Bekenntnis wurde so ernst genommen, dass - als Goethe der Kindheit längst entwachsen war - seine Verlobung mit Lili Schönemann aus konfessionellen Gründen scheiterte. Lili war nicht etwa katholisch oder jüdisch, sondern evangelisch-reformiert.
»Der Heiland hat mich erhascht«
Goethe kannte die Bibel von Kindheit an. Sie bewegte das Gemüt des Kindes mit der Anschaulichkeit ihrer Bilder, mit der Kraft ihrer Sprache, die auch die seine prägte und ihn bis ins hohe Alter begleitete. Seine frühesten dichterischen Versuche haben übrigens biblische Stoffe zum Thema, etwa "Die Höllenfahrt Jesu Christi", ein Bekenntnisstück, in der etwas schwülstigen Manier Klopstocks geschrieben.
Das geistige Klima Frankfurts vor einem Vierteljahrtausend wurde - kaum vermag man es sich noch vorzustellen - vom Geiste des Pietismus geprägt. Es war die Stadt Philipp Jakob Speners und des pietistischen Hauptpastors Fresenius, der einst schon Goethes Mutter Konfirmandenunterricht erteilt hatte. Einflussreich waren auch die bekannte Stiftsdame Susanna Katharina von Klettenberg und der Bischof der Brüdergemeine Spangenberg. An der Herrnhuter Synode in Marienborn von 1770 nahm Goethe teil und wäre dort - wie er später äußerte - "beinahe zum Anhänger geworden". Wie tief müssen den bereits Einundzwanzigjährigen die "Ergießungen einer schönen Seele" und der vielen Herrnhuter Brüder getroffen und bewegt haben!
Die religiöse Jugendentwicklung ist auch durch eine tiefe Krise geprägt, die sich in Leipzig ereignet. Eines Nachts bricht Goethe mit einem Blutsturz zusammen. Ein angehender Theologe, Ernst Theodor Langer, der auf dem gleichen Flur wohnt, nimmt sich rührend- fürsorglich seiner an. Langer ist ein gläubiger Christ von ebenfalls pietistischer Prägung. Erst im Jahre 1922 tauchten in Wolfenbüttel, wo Langer später als Bibliothekar wirkte, Briefe auf, die Goethe unmittelbar nach seiner Rückkehr an Langer gerichtet hat. Sie erweisen seine tiefe geistliche Bewegung. Er spricht von seinem Ernst, "die Winke der Gnade begierig aufzunehmen", und sagt sogar: "Der Heiland hat mich erhascht, er hat mich bei den Haaren... Ich halte den Glauben an die göttliche Liebe, die unter dem Namen Jesus Christus eine kleine Zeit dahinzog, für den einzigen Grund meiner Seligkeit."
Als Goethe 1768 "gleichsam als ein Schiffbrüchiger" in das Elternhaus zurückkehrte, traf er dort auf eine offenbar noch erbaulichere Welt mit regelmäßigen Versammlungen. Man trifft sich zu Andachten und religiöser Musik. Der Raum ist mit Blumen geschmückt, ein kaltes Buffet aufgebaut. Am Flügel wird musiziert, vor allem Choräle des Herrnhuter Gesangbuches. Goethe selbst trägt erbauliche Sprüche bei, entzündet die Kerzen, und alles vereinigt sich zu biblischer Betrachtung.
Nach Leipzig und Frankfurt folgt Straßburg. Die Mutter gibt dem jungen Studenten noch ein Losungsbüchlein der Herrnhuter Brüdergemeine mit, in dem die Losung des ersten Straßburger Tages angestrichen ist: "Mache den Raum deiner Hütte weit, und breite aus die Teppiche deiner Wohnung; spare nicht! Dehne deine Seile lang und stecke deine Nägel fest!" (Jesaja 54, 2)
In Straßburg gehören Theologen wie Johann Caspar Lavater und der fromme Jung-Stilling zu seinen Freunden und Gesprächspartnern. Auch dem Theologen Johann Gottfried Herder begegnet er (den er später als Generalsuperintendenten nach Weimar holen sollte). Und vielleicht ist es auch kein Wunder, dass er viel in dem Pfarrhause Brion in Sesenheim verkehrt und sich in die Pfarrerstochter Friederike verliebt, die Muse seiner ersten großen Liebesgedichte.
Zugleich wirkt die Begegnung mit Lavater auf den kritischer werdenden Straßburger Studenten Goethe als Provokation. Er wirft Lavater vor, das "Einreich Christi" absolut zu setzen, und fühlt sich von seiner "ausschließlichen Intoleranz" abgestoßen. Er verkraftet nicht, dass Lavater, der menschlich das "toleranteste, schonendste Wesen" sei, sich als "Lehrer einer ausschließenden Religion" darstelle. Demgegenüber macht Goethe seine Ansprüche auf Vielfalt und Toleranz deutlich: "In unsers Vaters Apotheke", schreibt er in einem Brief vom 4. Oktober 1782, "sind viele Rezepte" und: "Was sind die tausendfältigen Religionen anderes als tausendfache Äußerungen dieser Heilungskraft?" Ja, er versteigt sich Lavater gegenüber zu der Formulierung, er sei nicht Christ und nicht Antichrist, sondern "dezidierter Nicht-Christ": der Protest des jungen, nach geistiger Unabhängigkeit strebenden Genius gegen alle orthodoxe und pietistische Einengung - bewirkt gerade durch die missionarischen Tendenzen, ja Impertinenzen Lavaters und Jacobis.
"Keine Religion, die (bloß) auf Furcht gegründet ist, wird bei uns geachtet", heißt es in "Wilhelm Meisters Wanderjahren". Dagegen sei die des Menschen würdige Haltung die der Ehrfurcht, als religiöses Grundgefühl verstanden. Aber Furcht entfremdet ihn, verbiegt sein Selbstsein.
Die Ehrfurcht versteht sich für ihn in dreifacher Weise: gegenüber dem, was über uns, neben uns und unter uns ist. So repräsentiert sie auch die drei wirklich "echten" Religionen: die ethnische, die philosophische und die christliche Religion. Die erste ist die des Alten Testaments, die zweite die der klassischen Weisheit, zu der nicht nur die griechische Philosophie, sondern auffälligerweise bei Goethe auch Christus gehört.
Die höchste Stufe aber sei die dritte, die christliche Religion, "ein Letztes, wozu die Menschheit gelangen konnte und musste". Es ist die Nächstenliebe und die Agape, auch das Mitleid, das Hybris und Größenwahn des Menschen ausschließt, aber "auch Niedrigkeit und Armut, Spott und Verachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als göttlich anzuerkennen" vermag. Selbst Sünde und Verbrechen vermögen "Fördernisse des Heiligen" zu werden. Wer würde hier nicht Luthers "pecca fortiter, sed crede fortius" ("sündige tapfer, aber glaube tapferer") im Geiste mithören.
Allerdings hatte Goethe zu Leiden und Tod selbst ein ambivalentes, ja gestörtes Verhältnis. So erklären sich wohl auch die Emotionen, mit denen er das Kreuz Christi gelegentlich attackiert. Das Kreuz ist ihm ein Ärgernis: "das leidige Marterholz, das Widerwärtigste unter der Sonne!" Ihn stört die Darstellung der Marterinstrumente bei der Kreuzigung und die des Todes Jesu. Er will nicht den Gekreuzigten, sondern den Auferstandenen dargestellt wissen.
»Gott in der Natur, die Natur in Gott«
Erst im hohen Alter versöhnt er sich mit dem Kreuz, das er zugleich - übrigens wieder ein lutherisches Symbol - mit der Rose schmückt und damit das Todeszeichen mit einem Lebenssymbol zu überwinden sucht: "Das Zeichen sieht er prächtig aufgerichtet, / Das aller Welt zu Trost und Hoffnung steht, / Zu dem vieltausend Geister sich verpflichtet, / Zu dem vieltausend Herzen warm gefleht, / Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, / Das in so mancher Siegesfahne weht... / Er fühlet neu, was dort für Heil entsprungen, / Den Glauben fühlt er einer halben Welt... / Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen..."
Goethe strebt danach, die religiöse Enge durch eine umfassende lebensverbundene und Hoffnung kündende Weite zu sprengen. Das Gefühl von Größe und Freiheit war ihm wichtig und stand ihm zu. Daraus ergibt sich auch, dass er sich ungern festlegte, noch weniger sich festlegen ließ. Ob man ihn Pantheist, Atheist oder Christ nennen wollte, gelte ihm gleich viel - wie er einmal sagt -, "weil niemand recht wisse, was das alles eigentlich heißen solle".
Schon Schiller hat übrigens in einem Brief an seinen Freund Christian Gottfried Körner darüber geklagt, Goethe lasse sich stets eine Hintertür offen, durch die er verschwinden und sich entziehen könne. Im Brief vom 2. Februar 1789 schrieb Schiller dem verehrten Freund: "Er besitzt das Talent, die Menschen zu fesseln, und durch kleine und große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten."
Man kann diese Eigenschaft negativ werten und sein Genie mit einem Chamäleon vergleichen, wie es schon der Junge in einem Brief aus dem Jahre 1764 tut. Man kann aber auch - wie etwa Helmut Thielicke in seinem Buch "Goethe und das Christentum" - an die "Vieldimensionalität" seines Wesens erinnern. Ein universaler Geist, dessen Herz dennoch voll gläubiger Religiosität ist, sieht nicht nur eine Religion, sondern die Vielfalt aller Religionen, die auf den einen Gott und zugleich auf die eine Menschheit - das Divinum und das Humanum - ausgerichtet sind.
Hierin gründet Goethes Humanismus, ebenso in der griechisch-römischen Klassik wie im Judentum und Christentum wurzelnd, ja selbst fernöstliche Motive sind dem Verfasser des "Westöstlichen Diwans" nicht fremd. Auch hier darf man sich an Martin Luther erinnert fühlen, der ganz unorthodox das Spiegelverhältnis zwischen religiöser Persönlichkeit und dem Erscheinungsbild Gottes benennt: "Welcher Art jemand selbst ist, so erscheint ihm dann auch Gott" (zu Römer 3,5).
Bei der Betrachtung von Schillers Schädel widmet Goethe seinem so früh verstorbenen Freund einen Nachruf, an dessen Schluss es heißt: "Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, als dass sich Gott-Natur ihm offenbare?" Statt des Bindestrichs zwischen den Begriffen Gott-Natur könnte - so meinen wenigstens die meisten der Goethedeuter - hier auch ein Gleichheitszeichen stehen. Schon früh hat sich der Dichter dazu bekannt, "Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen".
Auch wenn er häufig die Etikettierung Pantheist ablehnt, benutzt er sie doch - in einem Brief vom 6. Januar 1813 an seinen alten Freund Jacobi - einmal selbst: "Ich für mich kann, bei den mannigfaltigen Richtungen meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben; als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher, und eins so entsschieden als das andere. Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt. Die himmlischen und irdischen Dinge sind ein so weites Reich, dass die Organe aller Wesen zusammen es nur erfassen mögen."
Das Wort "Gott" findet sich bei Goethe verhältnismäßig selten. Lieber gebraucht er Umschreibungen wie das Unendliche, das Ungeheure, das ewig Wirkende, der Weltgeist, die Weltseele, das unbekannte höhere Wesen, die waltenden Mächte, das Ewig-Eine in schier grenzenloser Mannigfaltigkeit. "Gott", so beklagt er sich einmal, werde vielen Menschen "zu einer Phrase, zu einem bloßen Namen, wobei sie sich auch gar nichts denken. Wären sie aber durchdrungen von seiner Größe, sie würden verstummen und ihn vor Verehrung nicht nennen mögen."
Gleichzeitig ordnet er aber der Natur, die er mit Gott gleichsetzt, Willen, Vernunft, Weisheit, Güte und Liebe zu. Und Gott weist er Persönlichkeitsqualitäten zu, wie Paul Fischer in seiner Studie "Gott - Natur" aus dem Jahre 1932 belegte: Leben, Bewegung, Tat kennzeichnen Gott. Und so lässt er Faust den Anfang des Johannesevangeliums mit den Worten übersetzen: "Im Anfang war die Tat." Was Goethe bewege, sei die heilige Scheu und Ehrfurcht vor dem Ewigen, dem Geheimnis, dem Unerforschlichen, das es "ruhig zu verehren" gilt.
»Ein Meister in der Kunst der Abgrenzung«
Der Gegenstand seiner Verehrung bleibt nicht immer anonym und von unbestimmter Allumfassendheit. Schon in "Dichtung und Wahrheit" schrieb er: "Mir aber möge man erlauben, dass ich den verehre, der in dem Reichtum seiner Schöp fung so groß war, nach tausendfältigen Pflanzen noch eine zu machen, worin alle übrigen enthalten, und nach tausendfältigen Tieren ein Wesen, das sie alle enthält: den Menschen." Hier ist nicht eine allschaffende Natur, sondern doch offenbar ein Schöpfergott gemeint.
Nicht Pantheismus ist seine Weltanschauung und sein Glaube, also die Gleichsetzung Gottes mit der Natur, sondern die Offenbarung Gottes in der Natur. In ihr findet er seine Spuren, in ihr verehrt er seinen schaffenden, grenzenlosen, allgewaltigen Geist. Nach eigenem Bekunden war er der Mensch, der Gott "in herbis et lapidibus", in Pflanzen und Steinen, suchen wollte. Darum gelingt ihm die wunderbare Fülle von Schilderungen der Schöpfung, von Lobpreisen der Sterne und Berge. Die Allliebe ist im Grunde das tiefste sowohl erotische wie religiöse Motiv, in dem die Liebe zur Natur und durch sie hindurch zum Schöpfer, zugleich aber auch zu einem geliebten Menschen sich durchdringen. Aber wie verhielt sich dann die Allliebe zum christlichen Prinzip der Nächstenliebe, zur Agape, zu seinem ganz konkreten Sozialverhalten?
Von Goethes Sozialverhalten wird Gegensätzliches berichtet. Er konnte sich während seiner Straßburger Studienzeit schützend vor seinen Freund Jung-Stilling stellen, wenn dieser wegen seiner naiv-pietistischen Frömmigkeit von raubeinigen Tischgenossen angegriffen wurde. Goethe finanzierte später die Drucklegung dessen Lebensberichtes, obwohl er seine Weltanschauung nicht teilte.
Er konnte andererseits als Weimarer Dichterfürst jüngere Kollegen, die sich ihm verehrungsvoll näherten, kühl abblitzen lassen. Hölderlin und Kleist mussten diese Erfahrung machen. Franz Schubert schickte ihm die Vertonung eines seiner Gedichte - Goethe schickte es kommentarlos, und man kann wohl auch sagen lieblos, wieder zurück. Goethe hat das Werk schlichter Nächstenliebe eines Johannes Daniel Falk mit wohlwollender Unterstützung begleitet, der sich der verwahrlosten Jugend zur Zeit der Freiheitskriege annahm und im Übrigen auch das von uns so geliebte Weihnachtslied "O du fröhliche" schrieb, über das Goethe äußerte: "Sein schlichter Glanz hat mich einfach hingerissen."
Aber sonst umgab ihn zumeist "die geheimrätliche Kühle" (Hanns Lilje). "Wahrscheinlich", so Lilje, "war sie nur eine Form des geistigen Selbstschutzes für einen Menschen, der sich nicht in jeder beliebigen Begegnung verbrauchen wollte. Goethe war ein Meister in dieser Kunst. Hinter der äußeren Erscheinungsform der olympischen Ruhe verbarg sich ein Mensch, der an Abgründen entlang geschritten war."
Und so bleibt es doch mehr eine Bekundung guten Willens, wenn er kurz vor seinem Tod äußert: "Mag die geistige Kultur nun immer fortschreiten, mögen die Naturwissenschaften in immer breiterer Ausdehnung und Tiefe wachsen und der menschliche Geist sich erweitern, wie er will - über die Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es in den Evangelien schimmert und leuchtet, wird er nicht hinauskommen!... Auch werden wir alle nach und nach aus einem Christentum des Wortes und Glaubens immer mehr zu einem Christentum der Gesinnung und Tat kommen."
Nicht Tod und Auferstehung Jesu sind für Goethe lebensentscheidende Fakten, sondern es ist - nach aufklärerischer Tradition - das Leben und Vorbild dieses einmaligen Menschen. Andererseits war er kein Rationalist, in dessen Denkgebäude Gott allenfalls als der gedankliche Schlussstein, als Inhaber der allerhöchsten Vernunft einen Platz hätte. Gott war für ihn die lebendige Urkraft, vor dessen unerforschlicher Majestät er eine ringende, auch nach Worten ringende ehrfürchtige Sehnsucht in sich fühlte. Auch hier gilt das Goethe-Wort "Gefühl ist alles - Name ist Schall und Rauch".
Goethe war gewiss kein Kirchenchrist oder Konfessionalist. Von allzu frömmelnden Zeitgenossen abgestoßen, hat er sich dennoch nicht der zu seiner Zeit schon verbreiteten agnostischen oder gar der atheistischen Version neuzeitlicher Aufklärung zugewandt. Im Gegenteil: Gerade wenn man im Sinne seiner Selbstdeutung seine Werke als "Bruchstücke einer großen Konfession" versteht, schließt sich der Kreis seines Lebens vom anfänglichen, milieuvermittelten Pietismus zu einer Altersgläubigkeit, die sich ausdrücklich in mehreren Bekundungen findet.
Die eine hat Eckermann aus seinem letzten Gespräch zu Goethes Lebzeiten festgehalten, wo dieser gesagt habe: "Ich halte die Evangelien alle vier für durchaus echt, denn es ist in ihnen ein Abglanz einer Hoheit wirksam, die von der Person Christi ausging, und die von so göttlicher Art ist, wie nur je das Göttliche erschienen ist. Ich beuge mich vor ihm als der göttlichen Offenbarung als des höchsten Prinzips der Sittlichkeit..."
Goethes letzte Lebenstage sind erfüllt vom Kampf gegen seine nun erschöpfte physische Natur. Am 22. März 1832 ergreift ihn "fürchterliche Angst und Unruhe", wie sein Hausarzt registriert, wahrscheinlich sein zweiter Herzinfarkt, dem er um die Mittagsstunde erliegt. Seine Schwiegertochter Ottilie - Frau und Sohn sind vor ihm verstorben - hält Goethes Hand. Als sie den Eindruck hat, der Tod sei eingetreten, löst sie ihre Hand von der seinen. Da flüstert Goethe: "Nun, Frauenzimmerchen, gib mir dein gutes Pfötchen!"
Wenige Augenblicke danach stirbt er. Ottilie bezeugt später: "Ein Hauptzug meines Schwiegervaters war, dass er nur reine Freude und Anerkennung empfand, wo ihm Großartiges entgegentrat, ja die Tränen traten ihm vor Bewunderung in die Augen. So habe ich ihn oft von Christus sprechen sehen, wollen Sie es Andacht nennen, Verehrung, Anbetung." Andacht, Verehrung, Anbetung wir dürfen es offen lassen.
©DS - DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT,
30. Dezember 1998 Nr. 1/1999
|